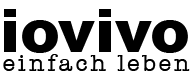Unter Tahiti hatte ich mir, wie wohl die meisten, das Paradies in der Südsee vorgestellt. Schöne Frauen mit Blumen im Haar an palmengesäumten weißen Stränden mit tiefblauem Wasser. An den Stränden von Moorea und dem weit entfernten Bora Bora sieht es auch tatsächlich so aus. Doch gehören sie zu Resorts, die nicht nur sündteuer sind, sondern auch weitab des Lebens außerhalb.
In zwei Tagen geht es für mich weiter, so dass ich mich in einem nicht ganz so sündteuren Resort in der Nähe von Papetee, dem Flughafen eingemietet habe. Im Terminalgebäude spielt eine Band mit Trommeln und Ukulele zur Begrüßung. Das ist hübsch. Nicht so hübsch, dass vom bestellten Hoteltransfer nichts zu sehen ist. Noch schlimmer, dass mir ein Anrufbeantworter verkündet, dass das Büro seit 17 Uhr geschlossen ist. Es ist 23 Uhr und einer der Momente, in denen ich mir unglaublich verlassen vorkomme.

Angekommen, verbreitet das Hotel den unvergleichlichen Charme französischer Hotelketten. Ibis, Mercure, Novotel, wer käme da nicht spontan ins Träumen? Von Geschäftreisen nach Heppenheim, Kassel oder Leipzig.
Das „Black Pearl“ ist eine weitläufige Anlage im Betonstil der 1980er Jahre. Ab und an sorgt ein Dach aus Palmblättern für den lokalen Akzent und kontrastiert kokett mit den dunkel eloxierten Aluminiumfenstern. Die Minibar ist leer, im Restaurant gibt es Hinano Bier und ordentliches französisches Fastfood. Das allerdings zu Preisen, die an anderen Orten so manches Gourmet Restaurants nicht zu verlangen wagen würde.
Auch der Vulkansand am Strand ist nicht weiß, sondern schwarz und so höllisch fein, dass er in wirklich jede Ritze dringt.
Melancholische Wanderung

Der Himmel ist wolkenverhangen, dennoch ist es drückend heiß als ich mich meinen Weg beginne. Es ist Sonntag, auf der Hauptstraße, die parallel zum Strand verläuft muss ich auf dem engen Bürgersteig alle paar Meter Jungen Platz schaffen, die mit Wakeboards auf dem Fahrrad unterwegs sind. Wir lachen uns an.
Ein junger Mann mit einer Plastiktüte nimmt mich wahr, überquert die vierspurige Hauptstraße und geht ein Stück hinter mir her. Er ist vielleicht Mitte 20, gut durchtrainiert, trägt Streetwear und eine gestrickte Camouflage Mütze. Ich werde langsamer, auch wenn es heller Tag ist, möchte ich ihn nicht in meinem Rücken haben.
Er sagt bonjour, wir gehen nebeneinander her und nachdem wir beide festgestellt haben, dass es ein verdammt heißer Tag ist, stellt er die üblichen Fragen nach meinem woher und wohin. „Buenos Días amigo“, er kann ein paar Brocken Spanisch. Papeete sei verdammt weit weg meint er.
„Nur noch fünf Kilometer“ sage ich, „was sollte ich sonst hier tun?“ Wir schütteln uns die Hand. „Stimmt“ sagt er, „es gibt wenig zu tun hier und es gibt auch keine Arbeit.“ „Was machst Du denn dann?“ frage ich.

Er grinst „ich bin Pflanzer“ und deutet mit einer Kopfbewegung auf die grünen Hügel, die sich ein paar hundert Meter landeinwärts erheben. „Karotten und so?“, zwinkere ich. „Nein, grüne Pflanzen!“
Ich halte die rechte Hand über meinen Kopf „etwa sooo hoch?“ „Und soooo dick“ sagt er und hält die Hände etwa einen Meter auseinander. „Und das geht gut?“ frage ich lachend. Er lächelt „Sehr gut sogar, ich sagte doch dass die Leute hier keine Arbeit haben“. Gras und Whisky.

Der Pflanzer biegt in Richtung Strand ab um ein paar Biere zu trinken, ich betrete einen kleinen Friedhof. Er liegt zwischen den Häusern mitten in einem Wohngebiet.
Die Gräber der armen Leute tragen schlichte weiße Kreuze, jene der Wohlhabenden Marmorplatten oder weiße Fliesen. Allen ist gemeinsam, dass nicht sehr viele Jahre zwischen Geburtsdatum und Todestag liegen. Kaum jemand schaffte es weit jenseits 70, erstaunlich viele wurden nicht einmal 60 und viel zu viele erreichten nicht einmal die Hälfte davon.
Es war mir zwar schon aufgefallen, dass viele Menschen hier nicht gerade schlank sind. Paul Gauguins Schönheiten haben ordentlich zugenommen. Dass allein das Übergewicht derart gravierende Folgen haben sollte, konnte ich mir auch nicht vorstellen. Eine mögliche Erklärung liefert mir Monique, die Bedienung der einzigen geöffneten Bar am Hafen von Papetee.
Frankreich hatte seit 1966 Atomwaffentests im Mururoa Atoll durchgeführt. Insgesamt 41 Bomben wurden dort bis 1996 (atmosphärisch und unterirdisch) gezündet, die strahlenden Teilchen fielen ins Meer.
Nun liegt Tahiti zwar 3.000 Kilometer vom Ort dieser Verbrechen entfernt, doch Fische wandern, Fischer fahren weit hinaus und bei einer Bevölkerung, die sich hautsächlich von Fisch ernährt, muss die Strahlenbelastung katastrophale Folgen gehabt haben. Es gibt allerdings nur sehr wenig „wissenschaftliche“ Daten zur Anhäufung der Fälle von Schilddrüsenkrebs in Französisch Polynesien. Warum sollte die Regierung auch Geld für Studien aufwänden, welche den unerfreulichen Verdacht auch noch beweisen würden?

Was ich von Tahiti sehe, wirkt so als hätte es schon längst bessere Zeiten gesehen. Es ist eine Atmosphäre des tropischen Verfalls. Das Paradies wird verdammt trostlos, wenn die ursprünglichen Strukturen dem Geld geopfert wurden und dieses plötzlich aufhört zu fließen.
Monique ist halb Slowakin und halb Polynesierin, sie hat in Paris und London gelebt, doch nun hat es sie in die Heimat ihrer Mutter verschlagen. Ich frage nicht warum. Sie berichtet weiter von 30% Arbeitslosigkeit und sehr großen Problemen mit dem Alkohol. Aha, deswegen war auch die Hotelbar schon um 22 Uhr geschlossen. Natürlich hilft das nicht wirklich, wie einstmals in England wird einfach früher mit dem Trinken begonnen und die Schlagzahl erhöht.
Gauguin ist lange tot und das Zentrum von Papetee auch. Bretterverschläge verschließen Schaufenster von Läden, die wohl schon vor Jahren aufgeben mussten. Ich habe gelesen, dass die Verbreitung von Graffiti ein Gradmesser für den sozialen Verfall einer Gegend sei. Wo niemand mehr ein Geschäft betreibt, oder eine bürgerliche Wohnkultur pflegt, bildet sich eine jugendliche Parallelkultur mit ihrer eigenen Zeichensprache.

Ich erreiche den Yachtclub von Papetee. Eine verblichene Wandmalerei kündet noch vom Träumen und Optimismus der Olympischen Segler. Was daraus wurde, weiß ich nicht. Ich fürchte jedoch, nicht allzu viel.
An einen der Tische im „Coconut Point“, dem kleinen Clubrestaurant, bestelle ich eine Flasche Bier, deren Etikett eine Gauguin Schönheit ziert. Dazu rohen Fisch mit Kokosmilch und Reis. Die lokale Spezialität. Das Lokal ist verhältnismäßig gut besucht, es ist dennoch sehr ruhig, die Gespräche sind gedämpft. Wir essen und blicken auf den kleinen Hafen, in dem die Boote still vor sich hingammeln. Die kleine Mahlzeit kostet mich fast 20 Euro, Tahiti ist ein teures Pflaster.

Die hohen Preise seien auch der Grund, warum die Touristen wegbleiben, erklärt mir der Fahrer auf dem Weg zurück ins Resort.
Ich hatte ihn zunächst für einen Obdachlosen gehalten, so wie er ein paar Meter von einem einsamen Taxi entfernt, mit freiem Oberkörper, im Schatten saß. Das ist dann auch das versiffteste Auto, in dem ich jemals gesessen bin. Das Armaturenbrett ist mit rotem Staub überzogen und zwischen den Sitzen herrscht ein unbeschreibliches Chaos aus zerknüllten Papiertaschentüchern, Essensresten und einer beachtlichen Sammlung von Strafzetteln. 20 Euro kosten die acht Kilometer. Das seien nun mal die Preise, er mache sie nicht.
Mein Flug startet um 3 Uhr morgens, ich bin dennoch heilfroh. Es gibt ein paar Orte, von denen ich sicher weiß, dass ich nie wieder dorthin zurückkehren werde. Tahiti steht jetzt auch auf dieser Liste. Eigentlich schade, die Menschen hier verdienen etwas besseres.