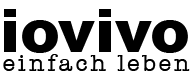Mit wem komme ich im Alltag besser zurecht – mit Seneca oder mit Buddha?
Mit dem stoischen Römer, der mir erklärt, dass die Welt hart ist, aber vernünftig geordnet, und dass ich mich gefälligst zusammenreißen soll? Oder mit dem indischen Prinzen, der mir sagt, dass die Welt weder Sinn noch festen Kern hat und ich sie besser nicht allzu ernst nehme – mich selbst eingeschlossen?
Beides klingt zunächst wenig tröstlich. Und doch sind es genau diese beiden Denkschulen, die mir das Leben leichter machen als alles, was mir monotheistische Religionen je angeboten haben. Die haben nämlich vor allem eines produziert: Schuld, Angst, moralische Erpressung – und seit ein paar tausend Jahren erstaunlich zuverlässig Ärger. Viel Ärger, Grausamkeit und Blutvergießen. Zwischen Menschen, zwischen Völkern, und nicht zuletzt im eigenen Kopf.
Seneca sagt: Akzeptiere die Ordnung der Welt, auch wenn sie dir nicht gefällt. Buddha sagt: Erkenne, dass es gar keine Ordnung gibt, an der du dich festhalten müsstest.
Der eine fordert Haltung, der andere Durchschauung. Und beide funktionieren – erstaunlich gut. Vor allem dann, wenn man sie nicht als Glaubenssysteme missversteht. Genau hier liegt der Unterschied zu den großen monotheistischen Erzählungen, die immer behaupten, es gäbe einen Plan, einen Willen, eine höhere Absicht – und merkwürdigerweise ständig Menschen brauchen, die diesen Plan mit Gewalt, Verboten oder moralischem Druck durchsetzen.
Ohne Gott gibt es keine Hölle
Seneca und Buddha brauchen das nicht. Sie kommen ohne Drohkulisse aus. Ohne Himmel, ohne Hölle. Und genau deshalb sind sie im Alltag oft deutlich alltagstauglicher.
Es gibt ein Phänomen, das mir seit Jahren auffällt: Menschen, die sich auf den Buddhismus berufen, wirken im Alltag oft erstaunlich fragil. Dünnhäutig. Reaktiv. Schnell verletzt. Während andere, die sich offen stoisch nennen, Epiktet und Seneca zitieren, erstaunlich stabil durchs Leben gehen. Das wirkt paradox, denn der Buddhismus gilt als Weg zur Gelassenheit, der Stoizismus dagegen als hart, beinahe unbarmherzig. Meine These ist einfach – und zugegeben ein wenig frech: Viele westliche Buddhisten sind schlicht keine Buddhisten. Sie sind etwas anderes. Und genau das macht den Unterschied.
Bevor jemand Schnappatmung bekommt: Ich nehme mich ausdrücklich selbst aus der Schusslinie. Ich habe keine Robe, keinen Ordensstatus, keine Erleuchtung. Ich habe lediglich Zeit, Erfahrung, ein paar Rückschläge, ein paar Erfolge – und eine gewisse Lust, Dinge nüchtern zu betrachten. Ironischerweise bringt mich genau das näher an den Buddhismus als viele Räucherstäbchen-Enthusiasten.
Der Stoizismus beginnt mit einer Annahme, die im Westen fast schon altmodisch wirkt: Du bist verantwortlich. Für dein Urteil. Für dein Handeln. Für deine Haltung. Die Welt ist, wie sie ist. Sie folgt einer Ordnung, die du nicht ändern kannst. Also lerne, dich selbst zu führen. Diszipliniere dein Denken. Werde innerlich unabhängig. Das ist keine Wohlfühllehre, sondern eine Charakterlehre. Sie richtet sich an Erwachsene, nicht an Menschen auf der Suche nach Trost. Seneca war reich, politisch verstrickt, mächtig – und wusste genau, wie schnell all das verschwinden kann. Seine Gelassenheit war keine Pose, sondern eine trainierte Fähigkeit – bis Selbstmord auf Befehl.
Der Buddhismus, zumindest in seiner ursprünglichen Form, setzt ganz woanders an. Er sagt nicht: Die Welt ist hart, also werde stark. Er sagt: Die Welt ist leer von Substanz, also halte sie nicht fest. Kein Schöpfer, kein Weltplan, kein kosmischer Sinn. Nicht einmal ein stabiles Ich. Alles entsteht bedingt, alles vergeht bedingt. Wer das wirklich versteht, wird nicht sentimental, sondern nüchtern. Sehr nüchtern. Und genau hier beginnt das westliche Missverständnis.
Immer der Ärger mit dem Ego
Viele sogenannte Buddhisten überspringen einen entscheidenden Schritt. Sie versuchen, das Ich aufzulösen, bevor sie überhaupt eines aufgebaut haben. Sie greifen nach Begriffen wie Leerheit, Loslassen, Nicht-Anhaften, ohne je Verantwortung, Disziplin oder innere Stabilität entwickelt zu haben. Das Ergebnis ist kein Buddhismus, sondern eine merkwürdige Mischung aus psychologischer Selbstrelativierung und moralischem Anspruch. Man fühlt viel, aber trägt wenig. Man akzeptiert alles – außer Zumutungen. Man redet von Mitgefühl und ist gleichzeitig erstaunlich empfindlich, wenn das Leben nicht kooperiert.
Echter Buddhismus ist das Gegenteil von weich. Er ist ent-romantisierend. Ent-sinnlichend. Ent-egoisierend. Er nimmt dir nicht die Verantwortung ab, sondern den Boden unter falschen Gewissheiten. Wer ihn ernsthaft praktiziert, wird nicht wankelmütig, sondern still. Weniger reaktiv. Weniger leicht beleidigt. Weniger interessiert daran, recht zu haben. Das ist psychologisch hochstabil – aber sozial unbequem. Deshalb ist echter Buddhismus im Westen selten. Er passt schlecht in eine Kultur, in der die Identität gepflegt wird wie ein Haustier.
Der Stoizismus hingegen passt erstaunlich gut. Er setzt ein Ich voraus, stärkt es, fordert es heraus. Erst wenn dieses Ich steht, kann es relativiert werden. Genau deshalb kippen Stoiker seltener. Sie wissen, wer sie sind, bevor sie lernen, sich nicht zu wichtig zu nehmen. Viele westliche Buddhisten versuchen das Gegenteil: sich nicht wichtig zu nehmen, ohne je gelernt zu haben, sich zu behaupten. Das ist kein spiritueller Fortschritt, sondern eine Abkürzung mit Nebenwirkungen.
Genieße was du hast, du kannst es nicht behalten
Ich sage das nicht von oben herab. Ich habe lange gebraucht, um das zu verstehen. Mein eigenes Lebensmodell – ortsunabhängig, mit wenig Besitz, aber viel Freiheit – wirkt auf manche buddhistisch. In Wahrheit ist es strukturell stoisch. Verantwortung, Selbstführung, Entscheidungskraft. Der buddhistische Teil kommt erst danach: die geringe Anhaftung, das Wissen, dass nichts davon wirklich mir gehört. Dass alles austauschbar ist. Dass ich jederzeit woanders neu anfangen könnte. Nicht aus Verzweiflung, sondern aus Gelassenheit.
Der Unterschied ist subtil, aber entscheidend. Stoizismus sagt: Bleib du selbst, egal was passiert. Buddhismus sagt: Erkenne, dass dieses Selbst kein festes Ding ist. Wer den zweiten Satz ohne den ersten versucht, verliert oft den Halt. Wer den ersten beherrscht, kann den zweiten gefahrlos denken – und darüber sogar schmunzeln.
Vielleicht ist das der Punkt, an dem ich dem Buddha näher bin, als es den Anschein hat. Ich nehme mich selbst nicht allzu ernst. Nicht mein Ich, nicht meine Rolle, nicht meine Geschichte. Ich weiß, dass all das Konstrukte sind. Aber ich habe gelernt, sie zu leben, bevor ich sie relativiere. Das ist kein spiritueller Trick, sondern eine Frage der Reihenfolge.
Wenn ich heute Menschen sehe, die sich buddhistisch nennen und gleichzeitig permanent überfordert wirken, denke ich nicht: Der Buddhismus taugt nichts. Ich denke: Das ist keiner. Nicht im eigentlichen Sinn. Buddhismus ist kein Lifestyle, kein Coaching-Tool, kein Instagram-Zitat. Er ist eine radikale Einsicht in die Struktur der Wirklichkeit – und die hält man nur aus, wenn man vorher gelernt hat, aufrecht zu stehen.
Vielleicht ist das die eigentliche Ironie: Der vermeintlich harte Stoizismus macht weich genug für den Buddhismus. Und der vermeintlich sanfte Buddhismus wird ohne stoische Vorarbeit zur Instabilitätsquelle.
Wer das verstanden hat, braucht keine Etiketten mehr. Und kann darüber lächeln wie Buddha.